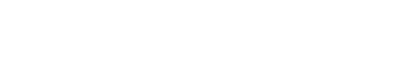Vita
|
Joachim Gottfried Müller
geboren am 8. Juni 1914 in Dresden gestorben am 3. Mai 1993 in Nürnberg Kreuzgymnasium Dresden Universität Edinburgh Hochschule für Musik Leipzig Dozent für Tonsatz an der Hochschule für Musik in Leipzig Kirchenmusikalisches Amt in Westberlin Dozent für Musiktheorie an der Fachakademie Nürnberg Stipendiat der Abraham-Lincoln-Stiftung Kunstpreis der Stadt Dresden |
Joachim Gottfried Müller
Born 8th June 1914 in Dresden Died 3rd May 1993 in Nuremberg Grammar School education at the Kreuzgymnasium in Dresden University of Edinburgh College of Music in Leipzig Lecturer in Music Theory at the College of Music in Leipzig Office responsible for Church Music (Kirchenmusikalisches Amt) in West Berlin Lecturer in Music Theory at the Nuremberg Academy of Music Scholarship from the Abraham Lincoln Foundation Arts Awards in Dresden |
Gottfried Müller wurde am 8. Juni 1914 in Dresden geboren.
Weh dem, der nicht glaubt! Zur Komposition schreibt er später:
„Das Schlüsselwort war das letzte Wort ,Herr, wir lassen nicht von Dir’. Hätte ich dem Werk diesen Titel gegeben und nicht auf Frau Elmendorff gehört, jedermann hätte sein Anliegen verstanden und es mir nicht seit 40 Jahren als Strick um den Hals gelegt. […]. In den Schlusssatz der ,Führerworte’ hatte ich den ,Uralten Ruff von Christo’ aufgenommen, […]. Die Partei nahm Anstoss an meiner Wortauswahl: ich hätte Christus hineingebracht. D a s aber gerade wollte ich ja. Denn ich glaube heute wie damals, dass allein diese Hinwendung den Hass, der alle Menschen erniedrigt, sie stehen hier oder dort, überwinden kann.“ (Gottfried Müller: Brief an Fred Prieberg vom 28.6.1984, Seite 3.) „Sie (die ,Führerworte‘) sind keine Verherrlichung Hitlers – sie streifen nicht einmal die typische Ideologie des NS, sondern sie reden von Glaube, Liebe, Mut, Respekt vor den Toten und sind ein Bekenntnis zu Gott […].“ (Gottfried Müller: Brief an Gottfried von Einem vom 24.4.1959, Seite 1.) „[…] ich hatte Freunde genug, die sich von Hitler abgekehrt hatten, die aber respektierten, welchen Sinn dieses Werk hatte und das eben mit der Auswahl der Worte an Kräfte appellierte, die eine Basis sein konnten gegen das Chaos des Hasses und der Hoffnungslosigkeit.“ (Gottfried Müller: Brief an Wolfgang Burbach vom 28.6.1970, Seite 1.) Der österreichische Komponist Gottfried von Einem, postum im Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet, war bei der Uraufführung in der Dresdner Staatsoper dabei: „Die Schlußnummer des Werkes, ein ,Amen’, ja selbst die Texte der anderen Teile lassen durch ihre Auswahl einen echten, ernsten Künstler erkennen.“ (Gottfried von Einem: Brief an Wolfgang Burbach vom 3.7.1970, Seite 2.) Und noch 1996 schreibt von Einem: „Er (Gottfried Müller) war ein großartiger Musiker. Die Hetze gegen ihn wegen der ,Führer-Worte’ wird nie abreissen, so lange es Hasser gibt. Ich kann mich gut an die Aufführung an der Dresdner Staatsoper unter Elmendorff erinnern – diese Kantate ist ein ausgezeichnetes Stück!“ (Gottfried von Einem: Brief an Brigitte Müller vom 17.4.1996, Seite 1.) 1944 wurde Gottfried Müller schließlich als jüngster unter 16 Komponisten in die Gottbegnadeten-Liste aufgenommen. Seine Freistellung im Krieg hatten Karl Straube und Wilhelm Furtwängler er-wirkt. Nach Kriegsende lebte er zunächst zurückgezogen im Pfarrhaus seines Bruders Christoph in Glaubitz bei Riesa und betreute die dortige Kirchenmusik. Müllers ablehnende Haltung zum Nationalsozialismus wird in einem Brief (wahrscheinlich an Professor Rudolf Volkmann) deutlich: „Ich erleide unter dem Alp unseres Zusammenbruches immer wieder seltsame Erschütterungen (die schweflige Dämonie Hitlers vergiftet auf schaurige Weise den Umkreis unseres Diesseits u. Jenseits), […].“ (Gottfried Müller: Brief vom 7.7.1945, Seite 3.) In Riesa lernte er auch seine spätere Frau Brigitte, geborene Bobe, kennen, die er 1947 heiratete. Aufgrund tragischer Umstände sollte die Ehe der beiden kinderlos bleiben. In Glaubitz komponierte Müller die Motette „Non moriar sed vivam“, die Günther Arndt 1951 beim evangelischen Kirchentag in Berlin uraufführte. Aber auch die Entstehungsgeschichte von Werken wie etwa der Solosonate für Oboe, 1957 in Philadelphia/USA uraufgeführt, der „Musik für Streicher und Pauken“, 1958 von Heinrich Hollreiser in Wien uraufgeführt, der Orgelpartiten „Nun komm, der Heiden Heiland“ und „Komm Schöpfer, heiliger Geist“ von Fritz Heitmann 1952 im Berliner Dom aus der Taufe gehoben, fällt in diese Zeit. Ab 1952 versah Müller ein kirchenmusikalisches Amt in Berlin-Hermsdorf. Hier brachte ihm die Freundschaft von Günther Arndt, Hans Joachim Moser und Hermann Böttcher viel schöpferischen Gewinn. Es entstanden u.a. das „Capriccio“ für großes Orchester (1962 von Heinrich Hollreiser in Mannheim uraufgeführt) und die Kantate „Von den Plagen und vom Licht“ nach Texten Pindars und der Bibel für Soli, Chor und Orchester. Von 1961 bis 1979 wirkte Gottfried Müller schließlich als Dozent für Musiktheorie am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg. Nun komponierte er u.a. seine „Dürersymphonie“, 1967 in Nürnberg von Heinrich Hollreiser uraufgeführt, eine Messe, Solistenkonzerte und eine beträchtliche Anzahl an Kammermusik- und Orgelwerken. Als außerordentlich fruchtbar erwies sich die Beziehung zu Karl-Friedrich Beringer, Leiter des Windsbacher Knabenchores von 1978 bis 2011. Für ihn und seine „Windsbacher“ schuf er zahlreiche a cappella Chormotetten, die Beringer über viele Jahre hinweg kongenial im In- und Ausland aufführte (darunter auch Japan und Südamerika). Doch in all den Nachkriegsjahren sollte Gottfried Müller auch immer wieder von den „Führerworten“ eingeholt werden. Bereits zugesagte Aufführungen oder Uraufführungen wurden kommentarlos abgesetzt und sogar der Versuch wurde unternommen, ein „Gedenkkonzert zum 90. Geburtstag“ in Nürnberg zu verhindern. Vorwürfe Minnegard Elmendorffs, die diese nach dem Krieg hinsichtlich der Begleitumstände zur Uraufführung der „Führerworte“ gegenüber Müller erhoben hatte „Er (Müller) verfaßte […] ein offizielles Schreiben an das damalige Propagandaministerium, in dem er meinen Mann und mich […] staatsfeindlicher Äußerungen bezichtigte […].“ (Fred Prieberg – Musik im NS-Staat, Seite 239 und 240.) taten ein Übriges, um ihn noch mehr zu diskreditieren. Wolfgang Burbach, Gründer und Geschäftsführer der Brüder-Busch-Gesellschaft, sah sich gar gedrängt, Müller nahezulegen, seine Mitgliedschaft in der Brüder-Busch-Gesellschaft zu kündigen: „Geradezu erschüttert hat mich aber die Rolle, die Sie offensichtlich im Fall Karl Elmendorff gespielt haben. Es steht mir nicht an, darüber zu urteilen, aber ich kann die Verbindung zu Ihnen nicht aufrecht-erhalten. Es ist auch damit zu rechnen, daß der Antrag gestellt wird, Sie aus der Brüder-Busch-Gesell-schaft auszuschließen. Um zu verhindern, daß die schmutzige Wäsche vor der Mitgliederversammlung gewaschen werden muß, empfehle ich Ihnen sehr, Ihre Mitgliedschaft zu kündigen.“ (Wolfgang Burbach: Brief an Gottfried Müller vom 15.6.1970, Seite 1.) Das veranlasste nun Gottfried von Einem, der um die damaligen Umstände wusste, zu einer Stellungnahme: „Ich kenne Herrn Müller seit fast 30 Jahren, bin mit ihm befreundet, kannte GMD. Elmendorff seit 1934 und habe die Entstehung und Uraufführung von Müllers Chorwerk ,Führerworte’ in der Dresdner Staatsoper miterlebt. […] Sind Sie (Wolfgang Burbach) unverwirr- und unfehlbar, dass Sie sich für berechtigt halten, die Umdüsterung des jungen Müller, der niemanden etwas zuleide tat, auch Herrn Elmendorff nicht, diffamierend ausnützen zu dürfen? Ich wurde im Jahr 1938 in Berlin von der Gestapo verhaftet. […]. Ich gab und gebe Müller trotzdem die Hand, weil ich ihn achte und zu würdigen weiß. Ob Frau Busch (Grete Busch, Witwe Fritz Buschs) mit Ihrem Ansinnen an Herrn Müller einverstanden ist und mit Ihrer bedauerlichen Haltung, wage ich zu bezweifeln.“ (Gottfried von Einem: Brief an Wolfgang Burbach vom 3.7.1970, Seite 1 und 2.) Gottfried Müller war entsetzt „Ich liebe Fritz Busch zu sehr und er bedeutet für mein Leben so viel, dass mich die Ächtung des Kreises, der sein Andenken in so schöner Weise pflegt, tiefer treffen würde, als Sie vielleicht ahnen.“ (Gottfried Müller: Brief an Wolfgang Burbach vom 28.6.1970, Seite 1.) und reagierte nun ebenfalls auf die Anschuldigungen Minnegard Elmendorffs. Er konnte sie allesamt widerlegen und nach gründlichen Recherchen kam Burbach wenige Monate später zu dem Ergebnis: „Ich habe Ihnen (Gottfried Müller) immer noch für Ihre beiden Briefe vom 24. und 29. September zu danken. Bevor ich sie zu den Akten nehme, möchte ich Ihnen versichern, daß mich Ihre Ausführungen davon überzeugt haben, daß Ihnen in der Angelegenheit Elmendorff Unrecht geschehen ist und sicher auch noch weiter geschehen wird. Sie dürfen versichert sein, daß ich alles in meiner Macht stehende tun werde, um zu Ihrer Rehabilitierung beizutragen.“ (Wolfgang Burbach: Brief an Gottfried Müller vom 19.11.1970, Seite 1.) Eine echte Rehabilitierung hat bis heute nicht stattgefunden; im Gegenteil, Minnegard Elmendorffs Unterstellungen wurden und werden Müller auch weiterhin ungeprüft angelastet und so setzt sich das Unrecht, das ihm in dieser Angelegenheit widerfahren ist, immer noch fort. Gottfried Müller starb am 3. Mai 1993 in Nürnberg. Seine letzte Komposition war die Motette „O Licht, geboren aus dem Lichte“. Als Psalmenkomponist trat er mit einem Werk für sechsstimmigen Chor und großes Orchester in die Welt der Musik, mit einer stillen, vierstimmigen a cappella Motette hat er sie wieder verlassen. Seinen wechselnden Lebensweg beschreibt der Pindartext: „Doch nichts will ich beklagen, denn mit allen werd’ ich es leiden“. |